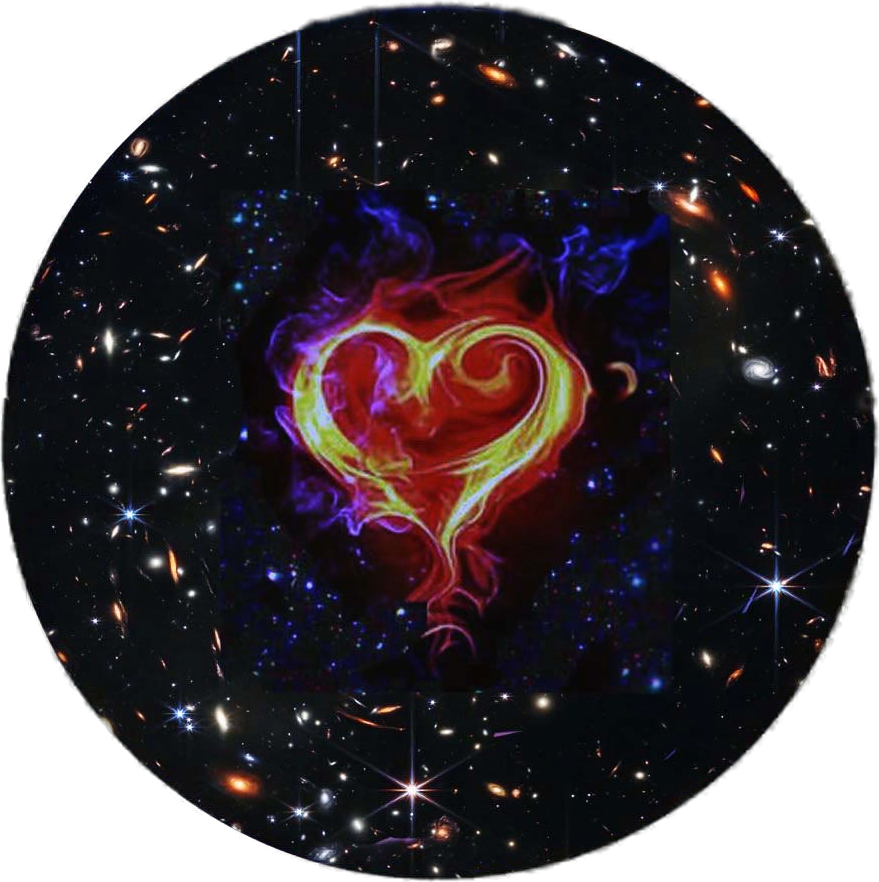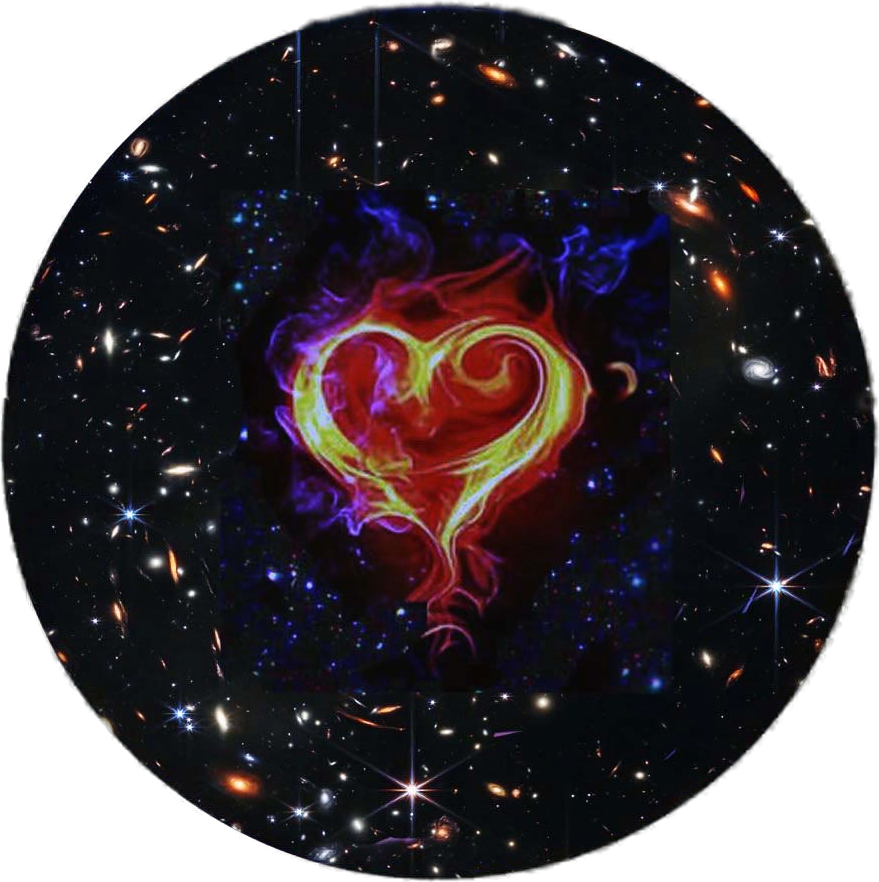Eigentlich ist das hier natürlich kein Prolog. Bezeichnen wir es doch einfach mal als eine vorläufige Bedienungsanleitung mit ein paar erklärenden Anmerkungen, die vermutlich dringend nötig sind, damit der "User" einigermaßen entspannt mit der Navigation klar kommt - und nicht dauernd wie ein Rohrspatz auf den unfähigen System-Administrator schimpfen muss.
Im Inhaltsverzeichnis (klick auf "Vorwort") finden sich zunächst alle 75 "Humoresken" - die durch einfaches Anklicken gelesen werden können. Die Struktur der einzelnen Nummern ist immer gleich.
Der "Head" der Geschichten besteht aus zwei Bildern und der Überschrift.
Das Funktions-Prinzip:
Klick auf das rechte Bild = nächste Geschichte >
Klick auf das linke Bild = letzte Geschichte <
Klick auf die Überschrift = Inhaltsverzeichnis i
Die Bilder sind allesamt mi KI generiert (Photo.Lab).
Stichwort künstl. Intelligenz: Alle Rezensionen sind 100prozentige, unbearbeitete Beiträge von ChatGPT. Was ursprünglich mal ein Versuch war, das hat sich zu einem Hauptbestandteil des ganzen Projektes entwickelt.
Ich hatte im Rahmen zahlloser diverser Experimente zur Probe mal - ohne jeglichen Kommentar - eine meiner Geschichten zu ChatGPT hochgeladen - und bekam postwendend eine Rezension zurück.
Und weil sich das ganze so grandios entwickelte, wurden alle anderen Geschichten peu à peu in gleicher Weise nachgereicht. Fazit: Mit seiner fast gnadenlos eloquenten Art hat ChatGPT für ein riesiges Plus in Sachen Unterhaltung gesorgt. -
Ausdrücklich sei aber darauf hingewiesen, dass ChatGPT allein für die Rezensionen zuständig ist. Im kreativen Bereich heißt es: "Wie müssen draußen bleiben!". Weil ChatGPT einfach nicht paraphrasieren kann, weil ChatGPT nicht fantasieren kann.
Die Humoresken stammen überwiegend aus den 90er Jahren - was eigentlich auch egal ist, da Aktualität letztlich sowieso keine Rolle spielt. Im Mittelpunkt des Geschehens steht das allgegenwärtige Chaos, das gleichermaßen in der Fantatsie wie korrespondierend in der Realität zunehmend um sich greift, der Kontrollverlust, der sich allenthalben manifestiert und sich nur noch notdürftig übertünchen lässt.
Bei der Bewältigung von Krisen findet so etwas wie Resilienz nicht statt - und wenn, dann garantiert ohne Lerneffekt. So wie nach der Covid-Epidemie. Wir machen weiter wie gehabt. Aufgearbeitet wird nichts: Scheiß auf verschleppte Paranoia und kollektiven Affekt-Stau! Bei der nächsten "Pandemie" stehen die Virulogen, Epidemiologen und die anderen üblich Kasperköpfe wieder wie der Ochs' vorm Berg - und sind aus unerfindlichen Gründen auch noch stolz darauf, dass sie nichts wissen.
So macht die Frage nach einem Konzept irgendwie keinen Sinn. Und weil sie keinen Sinn macht, wird sie auch nicht gestellt. Das Konzept ist quasi die Konzeptlosigkeit - ganz im Stil der neuen Zeit, da Superhirne wie der Multimilliardär Egon Musk in allen Bereichen - gemeinsam mit der AFD - neue intellektuelle Impulse setzt.
Und bevor sich am Firmament mal wieder etwas Innovatives abzeichnen könnte, gibt es unterm Strich künftig noch einiges an Klärungsbedarf - vor allem, weil offenbar die Welt der Quanten, die immer dichter in unseren Blickpunkt rückt, mit dem Makrokosmos nicht kompatibel scheint. (Siehe auch Epilog). So wissen wir nicht erst seit Einstein, sondern bereits seit der Heisenbergschen Unschärferelation, dass Relativität erheblich vielschichtiger ist als bisher angenommen. Dass die subjektive Position eine viel größere Rolle spielt als bisher angenommen.
Max Planck hatte etwa bereits vor über 120 Jahren festgestellt, dass es paradox sei, zum Beispiel Zeitintervalle für unendlich teilbar zu halten. Im Endeffekt entdeckte er das Phänomen , das später "Planck-Zeit" genannt wurde und die exakte Grenze zwischen Mikro- und Makrokosmos definiert.
Dabei gibt es noch zahllose weitere Grenzen, die sehr oft bestenfalls von theoretischem Belang sind, weil sie sich außerhalb unseres Wahrnehmungs-Horizontes befinden. Beispiel: Das Weltall divergiert bekanntlich, und zwar mit immer zunehmendem Tempo, mit annähernder Lichtgeschwindigkeit. Das heißt aber, dass wir einfach nicht mehr hinterher kommen! Auch für die berühmten Anhänger der Präastronautik sind die Kausalitätsketten längst gerissen: Die von vielen herbeigesehnten Außerirdischen haben sich längst verzischt! Es sei denn, sie sind in irgendwelchen kosmischen Clustern gefangen, die in "lokalen" Bereichen gravitativ wirksam sind. - - -
Dennoch haben wir schließlich doch eine einzige Frage an ChatGPT:
Was wissen wir über das Chaos - aus historischer, künstlerischer, humoristischer und Intellektueller Sicht, über seine Zukunft und eventuelle Unwägbarkeiten?
"Das Konzept des Chaos ist reich und vielschichtig, mit Wurzeln, die tief in die Geschichte, Philosophie, Kunst, und Literatur reichen. Es wurde sowohl als Bedrohung als auch als Quelle kreativer Energie betrachtet und hat in verschiedenen Kulturen und Epochen unterschiedliche Bedeutungen angenommen.
1. Historische Sicht:
Antike Mythen: In vielen Schöpfungsmythen, wie denen der griechischen Mythologie, wird das Chaos als der ursprüngliche Zustand beschrieben, aus dem die Ordnung (Kosmos) hervorgeht. Hesiod spricht in seiner *Theogonie* vom Chaos als der gähnenden Leere, aus der die ersten Götter hervorgingen.
Mittelalterliche und frühe Neuzeit: Im Mittelalter wurde Chaos oft als das Gegenteil von göttlicher Ordnung gesehen, eine Bedrohung, die durch göttliche und menschliche Eingriffe eingedämmt werden musste. Die Vorstellung vom Chaos als Vorstufe zur Schöpfung wurde jedoch auch im christlichen Kontext weiterentwickelt, wo Gott aus dem formlosen Urzustand die Welt erschafft.
2. Künstlerische Sicht:
Bildende Kunst: Künstler haben das Chaos häufig als eine Quelle kreativer Inspiration betrachtet. Der Surrealismus, etwa, versuchte, das Unbewusste zu erkunden, oft durch Bilder, die das Gefühl von Unordnung und Absurdität hervorrufen. Jackson Pollocks "Action Painting" ist ein Beispiel für eine künstlerische Technik, die bewusst das Unkontrollierte und Chaotische in den kreativen Prozess einbindet.
Literatur: In der Literatur wird Chaos oft metaphorisch eingesetzt, um innere oder äußere Konflikte darzustellen. In der modernen Literatur zeigt James Joyce in "Ulysses" und "Finnegans Wake" eine narrative Struktur, die das Chaos der Gedanken und der Welt widerspiegelt.
3. Humoristische Sicht:
Chaos wird in der humoristischen Tradition oft als Quelle absurder Komik verwendet. Der „Slapstick“-Humor beispielsweise nutzt chaotische Situationen, in denen die Regeln der Ordnung aufgehoben sind, um Lachen zu erzeugen. Klassiker wie Charlie Chaplins „Moderne Zeiten“ oder die anarchischen Komödien der Marx Brothers spielen mit dem Chaos, um soziale und gesellschaftliche Normen zu hinterfragen.
4. Intellektuelle Sicht:
Philosophie: In der Philosophie steht Chaos oft in einem dialektischen Verhältnis zur Ordnung. Philosophen wie Friedrich Nietzsche sahen im Chaos eine notwendige Bedingung für die Schöpfung neuer Werte und Ordnungen. In seiner Vorstellung des „Übermenschen“ ist das Chaos ein Raum, in dem alte Ordnungen zerstört und neue geschaffen werden können.
Naturwissenschaften: In den modernen Naturwissenschaften, insbesondere in der Chaostheorie, wurde das Chaos als inhärentes Merkmal dynamischer Systeme erkannt. Es zeigt, dass auch in scheinbar unordentlichen Prozessen eine zugrunde liegende Ordnung oder Struktur vorhanden sein kann.
5. Zukunft und Unwägbarkeiten:
Technologische und gesellschaftliche Veränderungen: Mit zunehmender Komplexität moderner Technologien und globaler Systeme könnte das Risiko von Chaos in der Gesellschaft zunehmen. Themen wie Klimawandel, politische Instabilität und technologische Singularität werfen Fragen auf, wie wir mit potenziellen chaotischen Entwicklungen umgehen werden.
Kreatives Potential: In der Kunst und Wissenschaft könnte Chaos auch weiterhin als Quelle für Innovation und Veränderung betrachtet werden. Der Umgang mit Unvorhersehbarkeit und Komplexität wird wohl eine zentrale Herausforderung der Zukunft sein." - - -
Als exemplarisches Schlussbild poppt ein junger Mann auf - der offenbar zum ersten Mal wählen durfte - und beschreibt, warum so viele Yountimer sich überraschenderweise für die FDP als Partei ihres Herzens begeistern konnten.
Christian Lindner, so der Jungwähler sinngemäß, mache mit seinem "jugendlichen Elan" am ehesten den Eindruck, dass er "Probleme wie die Digitalisierung in den Griff bekommen" könne...
Gute Nacht, Marie!
Peter Kretzschmar